Als der Wecker an diesem beschaulichen Sonntagmorgen um fucking 3:30 AM klingelte, stellte ich meine ganze Existenz in Frage. Warum dachte ich, das sei eine gute Idee? Achja: Weil die Lagune 69 quasi der Spot der Region ist, den man einfach gesehen haben muss. Davon musste ich mich also selbst überzeugen. Also quälte ich mich in meine Klamotten und los ging's.
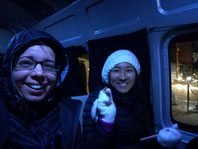
Trotz Taxi waren wir erst um Viertel nach Vier am Tourplatz. Interessierte auch keinen, wir mussten natürlich trotzdem auf den Van warten. Wir bemühten uns diesmal um mittigere Plätze - heißer Tipp am Rande, denn hinten sitzt es sich holpriger. Wir sind dann auch losgefahren... dann wieder zurück, haben nochmal Leute eingesammelt und sind nochmal losgefahren. Achja. So genau hinterfragte ich das um halb5 morgens nicht.
Es ging wieder los Richtung Norden, diesmal bogen wir aber bereits in Yungay Richtung Nationalpark ab und dort verließen wir dann auch die asphaltierten Straßen. Erstaunlich, denn auf dieser Strecke lag immer noch die ein oder andere Ortschaft!
Frühstückspause

Gegen 07 Uhr machten wir dann zum ersten Mal Halt – irgendwo in der Pampa von Huashao, den alle Touren für ihr Frühstück erkoren hatten. Die zwanzig Minuten Pause waren allein deswegen unmöglich zu halten, weil wir die Zeit bereits zum Anstehen gebraucht hatten. Meine Güte war da viel los, in aller Herrgottsfrühe mitten im Nirgendwo! Gestärkt mit zwei Semmeln und versorgt mit einem guten Mate de Coca, ging es schließlich weiter. Mittlerweile malte auch die Sonne ihr Licht auf die Bergspitzen und ich habe mich an Morgende in den italienischen Dolomiten zurückversetzt gefühlt. Ein schöner Anblick!
In unserem Van fehlte zwar plötzlich der Guide, aber wir vermuteten alle einfach, das er in einen der anderen Busse zugestiegen war. Dumm war nur – wir brauchten ihn, um in den Nationalpark zu kommen, denn er hatte bereits unser Geld dafür einkassiert.
Kleiner Fakt am Rande: Für die Lagune69 wird ein höherer Eintritt verlangt als für den Rest des Nationalparkes und es gilt: Locals 15 Soles, Touris 30 Soles. Tja und mit meinem Visum galt ich schon soweit als Vollblut-Peruaner, dass ich nur den halben Preis veranschlagen musste :-)
Kaum im Nationalpark angekommen, wurden wir erneut mit traumhaften Aussichten belohnt. Während die anderen noch versuchten ein wenig zu schlafen und Kraft zu tanken, konnte ich mich einfach nicht satt sehen. Umso beeindruckender wurde es, als wir schließlich die Doppelseen Llanganuco (Chinancocha & Orconcocha) passierten. Mir fiel bei diesem Anblick wortwörtlich die Kinnlade herunter.
Daher war ich ein wenig enttäuscht, das wir dort keinen weiteren Zwischenhalt machten. Manchmal ist das in den Touren mitinbegriffen, allerdings hatten wir uns so viele Angebote angehört, das ich da vielleicht etwas durcheinander gebracht habe – und wir hatten ja auch etwas Zeit verloren. So ein Pech, dann muss ich wohl nochmal nach Huaraz fahren und das nachholen!
Los geht die Wanderung
Unsere Nationalpark-Eintrittskarte wurde einmal gestempelt und dann ging es gegen 09:20 Uhr los mit der Wanderung. Jeder ging in seinem Tempo – wir waren ja nicht die einzige Tour. Der Weg ist wirklich super simpel: Es gibt nämlich nur einen. Also: einfach den Leuten nach!
Wir befinden uns hier an einem Ort, der sich unmöglich auf Fotos festhalten lässt. Ich bin mit meinen Gedanken soweit gegangen, das ich mir wirklich dachte: Das ist paradiesisch! Ja es stimmt, es waren viele Leute unterwegs, aber die tangierten mich alle nur periphär. Die zerklüfteten Berge um mich herum, nicht ein, sondern sogar zwei Wasserfälle, die Bäche, die davon abflossen, die Sträucher, die ganze Umgebung: Es sah fantastisch aus. Und es war so ruhig! Keine hupenden Autos, kein Scharren von Reifen, kein Surren der Maschinen – nichts! Ich habe mir direkt zu Beginn gedacht: Egal was kommt, allein hier zu sein und all das zu sehen, aufzunehmen, hat sich bereits gelohnt! Nun, später sollte ich anders darüber denken – ich komme darauf zurück.
Wir marschierten also gemütlich darauf los und sogen die Natur förmlich auf. Anfangs war alles relativ flach, doch als es steiler wurde, fiel ich immer häufiger hinter meinen beiden Begleitern zurück. Gegen 11 Uhr machten wir eine längere Verschnaufspause. Ein Vorsprung am Berg eignete sich perfekt dafür und wurde daher von allen entsprechend genutzt. Jemand rief, von hier aus seien es nur noch eine oder 1,5 Stunden bis zur sagenumwobenen Lagune. Schaffbar, dachte ich! Außerdem: Man sah die Kuppe ja schon! Ich war an diesem Punkt schon ziemlich ausgelaugt, aber noch motiviert – mit den Informationen jetzt, war ich davon überzeugt, das würde ich nun auch noch schaffen! (Sie stellten sich nur leider als unwahr heraus.)
Diese besagte Kuppe war ein ordentlich steiles Stück den Berg hinauf. Ich hatte auf diesem Stück ganz schön zu kämpfen! Als sie dann schließlich bezwungen war und ich glaubte mir jetzt die Lagune 69 verdient zu haben, wurde ich bitter enttäuscht. Vor mir lag ein kleiner See, ja, einer Pfütze gleich und ich erinnerte mich, davon gelesen zu haben, dass dies nur ein weiterer Zwischenstopp auf dem Weg war. Aber allzuweit konnte es ja dann nicht mehr sein – oder?
Hinter dem kleinen See im Grünen ging es erstmal flacher weiter. Das war definitiv eine Erleichterung, wenn auch meine Beine schon ganz schön schwer geworden waren. Ich hoffte hinter jeder Biegung die Lagune zu entdecken und dann kam es: Das Schild mit der Aufschrift “Lagune 69: 1 KM”
Ich folgte der Richtung mit meinem Blick, schluckte und setzte mich erstmal auf einen großen Felsbrocken.
Wenn Zweifel an dir nagen
Ein Kilometer. Das war nicht sooo viel. Wir hatten gerade gegen 12 Uhr Mittags und dennoch wusste ich: Für diesen Kilometer würde ich bestimmt locker eine Stunde brauchen. Also saß ich da auf meinen Stein und überlegte ernsthaft: Wollte ich weitermachen?
Ich war bereits fix und fertig. Der Aufstieg bis hierhin hatte mir mehr abverlangt, als ich zuzugeben bereit war. Ich konnte nicht mehr. Aber wie sah die Alternative aus? Umdrehen? Ja, ne – ich konnte doch jetzt nicht kehrtmachen, nicht so kurz vor dem Ziel! Außerdem war ich mir nicht ganz sicher, ob es denselben Weg auch zurückging oder nicht und am Ende stand ich irgendwo, wo niemand war. Mal ganz davon abgesehen hatte ich nur Früchte in meinen Rucksack, die Sandwiches hatte nämlich Chipi eingepackt. Ein Kilometer. Ein verdammter Kilometer. Ich ging den Weg mit meinen Augen ab: Vor mir lag eine weitere Kuppe und ich hatte die Erste bereits liebevoll “Kuppe des Todes” getauft. Wie hoch waren wir eigentlich? Ein Kilometer. Schließlich seufzte ich, stand auf und ging einfach weiter. Was sollte ich auch sonst machen?
Die ungeschönte Wahrheit
2017 nahm ich an einem Teambuildungsprogramm der Arbeit teil, in dem wir ebenfalls 3-4 Stunden einen Berg hinauf wandern sollten. Der Haken: Es schüttete aus Eimern. Nach dem Aufstieg fragte uns der Trainer, ob wir uns nicht großartig fühlten, weil wir ein solch entferntes Ziel erreicht hatten. Damals jedoch hatte ich keinerlei Zweifel verspürt, den Aufstieg - trotz des Regens und der Kälte - zu schaffen.
Es mag seltsam klingen, aber genau diese Erfahrung von vor zwei Jahren ging mir in dem Moment durch den Kopf, als ich so auf dem Berg hing. Denn diesmal hatte ich Zweifel. Große Zweifel. Ich kam kaum vorwärts. Ich befand mich zwischen Hunderten von Wanderern und war doch alleine. Jeden kleinen Schritt bezahlte ich mit Atemnot. Das Wort Verschnaufspause bekam eine ganz neue Bedeutung. Ernsthaft. Ja, mir schmerzten die Füße, ja, meine Kraft ließ nach, aber das größte Problem stellte eindeutig die Luft da. Oder besser gesagt: Die zu wenig vorhandene Luft. Ich machte ein paar wenige, kleine Schritte und setzte mich wieder auf den nächstbesten Stein. Durchatmen. Warten bis das Herz wieder etwas langsamer schlägt. Aufstehen. Weitergehen. Fünf Schritte, sechs. Wenn ich gut war: zehn. Hinsetzen. Atmen.
Es war eine Tortur. Für die fantastische Aussicht hatte ich längst keinen Blick mehr übrig. Ich schnaufte und keuchte wie noch nie zuvor in meinem Leben. Panik stieg in mir hoch. Was, wenn ich es nicht schaffte? Was, wenn ich wieder umkippte? Was, wenn ich irreparable Schäden heraufbeschwor, wenn ich weitermachte? Wie sollte ich von diesem Berg je wieder herunterkommen? Ich hatte Angst, kannte meine Grenzen nicht. Dennoch bemühte ich mich die Verzweiflung in Zaum zu halten, denn ich bemerkte sofort wie scheiße schädlich diese negative Gedankenspirale war. Es war nicht nur eine Kopfsache – in Panik beschleunigt sich die Atmung und die Luft zum Atmen war noch nie so verdammt wichtig für mich gewesen. Bei der dünnen Luft bemerkte ich die Auswirkungen davon sofort. Dieses Gefühl wie tief und doch schnell, die Lungen den Sauerstoff einsogen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, diese Mutlosigkeit zu vertreiben und die Fragen, die Zweifel schürten, verstummen zu lassen. Vielleicht war schlichtweg das Bewusstsein darüber präsent, dass es nur noch schlimmer werden würde, wenn ich der lockenden Angst nachgab. Ich zwang mich ruhig zu bleiben und fütterte mich mit hoffnungsvollen Gedanken. Wie, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich von Grund auf optimistisch bin. Dennoch will ich nicht vergessen, wie haarscharf ich an einer Panikattacke vorbeigeschlittert bin und wie dieses ganze Abenteuer leicht anders hätte ausgehen können.
Mein Denken lief irgendwann nur noch auf Minimumbetrieb, im Grunde agierte der Körper fast von alleine. Höher und Weiter. Höher und Weiter. Höher und Weiter. Wortwörtlich. Und warum? Weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Ich war nicht einmal in der Lage nochmal zu überlegen, ob ich nicht besser umdrehen sollte. Der einzige Trost? Immer wieder sah ich auch diesselben Gesichter und so wusste ich: Ich war nicht die Einzige die so sehr mit der Höhe zu kämpfen hatte.
Als Leute uns entgegenkamen, wollte ich jedesmal fragen: Wie weit noch? Wie weit? Doch oft waren sie zu schnell und ich zu langsam, zu leise. Einmal lehnte ich mich nur noch auf einen großen Felsbrocken, lag halb mit dem Oberkörper darauf, da an der Stelle keine passende Sitzmöglichkeit vorhanden war. Ich konnte mich ja nicht mitten auf den Weg setzen, dafür war er zu schmal. In diesem Moment kamen zwei Wanderer direkt auf mich zu und fragte, ob alles in Ordnung sei. Nein, gab ich ganz ehrlich zur Antwort. Die Norm, Unannehmlichkeiten hinunter zu spielen, hatte ich längst über Board geworfen. Sie gaben mir Schokolade, ein Zitronenbonbon und machten mir nochmal Mut. Zucker! So wichtig. Ich hatte beides zwar selbst im Rucksack gehabt, aber hatte ich daran gedacht? Natürlich nicht. Tatsächlich frage ich mich ein wenig, ob ich es ohne diese zwei Wanderer, die hingesehen hatten und aufmerksam waren, trotzdem geschafft hätte. Aber das wäre wohl etwas sehr dramatisch ausgedrückt – oder?
Nach dem Verzehr war mir erstmal super schlecht und ich wartete geduldig auf einem weiteren Stein, bis sich das Gefühl legte. Dann bewältigte ich die letzten Meter.
Hat sich der Anblick der Lagune schließlich gelohnt? Das könnt ihr nächste Woche im Teil 2 nachlesen!
Kommentar schreiben